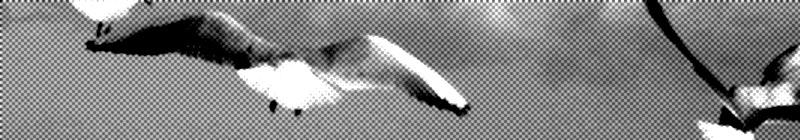Verführerisch-melancholischer, von feinem Songwriting getragener Indie Pop, der einem beim Hören im Nu kleine Prisen von Freiheit, Unterwegssein und Alltagsflucht auf die Zunge zaubert. Eine aufs Wunderschönste faszinierende Stimme, der das Samtig-weiche à la BOY ebenso zueigen ist wie das Soulig-raue einer Leslie Feist.
All das – und mehr – macht Panos Single „Hang In“ aus. In dieser geht es laut ihr um das Gefühl, etwas tun zu wollen, aber nicht zu wissen, wo man anfangen soll. Außerdem um Situationen, in denen man an sich selbst und seinem eigenen guten Willen zweifelt. Vor allem der Refrain des Stückes gerät emotional durchaus mitreißend, während die Stimme einmal mehr ihre beruhigende Wirkung zeigt. Und das, obwohl die Stimmung, Melodie und das Thema des Songs eher herbstlich-melancholisch anmuten. Dass das Thema von „Hang In“ ein ernstes ist, sagt Pano selbst:
“Bei ‘Hang In’ geht es um das Gefühl, etwas tun zu wollen, aber nicht zu wissen, wie und wo man anfängt, während die Uhr sich laut tickend weiter dreht. Darum, dass man sich immer wieder versucht einzureden, dass doch alles schon irgendwie ok werden könnte, wenn man nur noch ein bisschen mehr Geduld hat. Um Situationen, in denen man sich selbst und den eigenen guten Willen anzweifelt, weil man tatenlos und gelähmt zuschaut, wie so viele Dinge den Bach runtergehen. Ich denke, viele kennen die Angst, vor lauter Informationsfluten und Missständen nichtstuend im Welthass zu versinken. Mit ‘Hang In’ habe ich ein Gefühl festgehalten, welches den Versuch ‘hoffnungslos die Hoffnung nicht zu verlieren’ für mich ganz gut beschreibt.”
Dass die Nummer keineswegs eine qualitative Eintagsfliege darstellt, beweist das unlängst erschienene selbstbetitelte Debütalbum. Selbiges, den Nachfolger zur 2020 veröffentlichten „Water EP„, nahm Pano, die eigentlich Verona heißt, in Berlin wohnt und dort als Sozialarbeiterin arbeitet(e), in Málaga zusammen mit Produzent Ralf Christian Meyer auf. Die finanzielle Grundlage hierfür bildete das Preisgeld, das die Musikerin vor drei Jahren als Gewinnerin bei einem Newcomer-Wettbewerb einheimste, bei dem sie sich gegen amtliche 2.500 andere Acts durchgesetzte – völlig zurecht, möchte man beim Hören des Langspielers nun meinen, der neben „Hang In“ oder dem tänzelnd-treibenden „Indiesmasher“ auch in sich ruhende Momente wie „Dreamlands“ oder „Yours To Keep“ enthält. Also erstmal zurücklehen, denn irgendwann, irgendwann wird die Sonne wieder durchs triste Wintergrau hervor lugen…
Wer Pano gern live und auf Bühnenbrettern erleben mag (kleiner Spoiler: es lohnt sich!), der hat sowohl derzeit die Gelegenheit (die Newcomerin ist aktuell als Support des geschätzten Betterov unterwegs) als auch im April des kommenden Jahres, wenn die Berliner Indie-Musikerin einige Shows mit ihrer Band spielen wird.
— Support für Betterov —
23.11. Bremen – Modernes
24.11. Münster – Skaters Palace
26.11. Köln – Carlswerk Victoria
27.11. Oberhausen, Ebertbad
28.11. Hannover – Capitol
29.11. Hamburg – Große Freiheit
01.12. Erlangen – E-Werk
02.12. Leipzig – Felsenkeller
Tickets HERE
— Cut The Corners Tour 2024 —
09.04.2024 Leipzig – Werk02 // mit nothingspecial
10.04.2024 Köln – Blue Shell
11.04.2024 Hamburg – Molotow Sky Bar
12.04.2024 Berlin – Privatclub
Tickets HERE
Rock and Roll.